Vorbemerkung
Chatbots haben den Charakter einer Universaltechnik. Sie sind nicht zweckgebungen und überall einsetzbar. Deshalb finden Sie hier keinen klassischen Betriebsvereinbarungs-Text, sondern Überlegungen, wie man damit umgehen kann, dass die Chatbot-Technik sich in nahezu allen Arbeitsbereichen durchsetzen wird und dass es wichtig ist, einen kompetenten Umgang mit den neuen Werkzeugen zu lernen.
Einführung von Chatbots
Merkpunkte für eine begleitende Betriebsvereinbarung
 Fast jeder benutzt heute Chatbots. Die Firmen haben mittlerweise entdeckt, dass es sich dabei um brauchbare Arbeitsmittel handelt. Es gibt inzswischen auch keine Softwarefirma mehr, die nicht behauptet, ihre Produkte seien voll mit Künstlicher Intelligenz.
Fast jeder benutzt heute Chatbots. Die Firmen haben mittlerweise entdeckt, dass es sich dabei um brauchbare Arbeitsmittel handelt. Es gibt inzswischen auch keine Softwarefirma mehr, die nicht behauptet, ihre Produkte seien voll mit Künstlicher Intelligenz.
Inzwischen haben viele Firmen ihre eigenen Chatbots, oft eines der Standardmodelle von OpenAI, Google oder Anthropics (seltender Grok von Elon Musks Firma xAI), aber mit zusätzlichen internen Firmendaten trainiert.
Die Einführung der Chatbot-Technik in den Betrieben bietet kein systematisches Bild, scheint oft dem Muster trial and error zu folgen. Oder man hängt sich einfach an Microsofts Copilot dran. Das erscheint vielen Firmen als der einfachste Weg. Dabei handelt es sich um Software as a Service (SaaS), direkt aus der Cloud, und es gibt genug best practice-Vorschläge, um das System schnell einzurichten. Damit stehen einige KI-Komponenten zur Verfügung: der Chatbot ChatGPT von OpenAI, die Suchfunktion Bing, ein Sprache-zu-Text-Tool (Transskription), eine Zusammenfassungsfunktion in teams und natürlich die versprochenen KI-Agents. Die sind aber nur versprochen (Stand Sommer 2025).
Vorbereitung einer Vereinbarung
Es ist wichtig, dass die KI-Technik allgemein als ein Mittel zur Unterstützung der Arbeit und nicht als Ersatz der von Menschen geleisteten Arbeit gesehen wird. Die Technik ist ein Werkzeug, mit dem man intelligent umgehen sollte, keine Maschine, die die Arbeit ersetzt.
Die Chatbot-Technik ist in der Lage, die Arbeit von vielen lästigen Routineabläufen zu entlasten. Schon die Möglichkeit der Sprache als Eingabemedium ist im Vergleich zum lästigen Eintippen oft eine Erleichterung.
Man konnte in letzter Zeit beobachten, dass viele Menschen die Benutzung eines Chatbots anstelle der oft umständlichen Google-Suche bevorzugen, aus den einfachen Gründen, weil es schneller geht und als angenehmer empfunden wird.
Die vielfältige Nutzbarkeit der Chatbots macht es schwierig, für sie einen Vewendungszweck festzulegen. Hier eine  kurze Erklärung.
kurze Erklärung.
 Ich persönlich halte nicht viel davon, die Zwecke des Einsatzes von Chatbots in einer Aufzählung festzulegen, jedenfalls nicht zum augenblicklichen Zeitpunkt. Die Technik selber steckt noch in einem zu
rasanten Entwicklungstempo. Zur Begründung zwei Argumente:
Ich persönlich halte nicht viel davon, die Zwecke des Einsatzes von Chatbots in einer Aufzählung festzulegen, jedenfalls nicht zum augenblicklichen Zeitpunkt. Die Technik selber steckt noch in einem zu
rasanten Entwicklungstempo. Zur Begründung zwei Argumente:
- Bis vor noch nicht allzulanger Zeit war das „Wissen“ der Chatbots mit dem Datum ihres letzten Trainings sozusagen beendet. Jetzt haben sie gelernt, eine Internetsuche zu starten, wenn sie bemerken, dass ihre Trainingsdaten nicht ausreichend sind. Die im Internet gefundenen Ergebnisse können sie dann sprachlich aufbereiten und mit ihren im Training erworbenen Fähigkeiten kombinieren.
- Die noch relativ neue Technik des Reasoning macht es den Chatbots möglich, auch komplizierte und komplexe Anfragen in einzelne Teilaufgaben zu zerlegen, die verschiedenen Aspekte darzuzstellen und dann wieder zusammenzufassen. Dadurch erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten beträchtlich.
Was das nächste Jahr an Neuerungen noch bringen wird, kann niemand ernsthaft voraussagen. Mir scheint es daher sinnvoller, sich auf eine gemeinsame Gestaltung einer Experimentierphase zu verständigen, die neue Technik sozusagen unter eine wohlwollende aber kritische Beobachtung zu stellen. Wenn man dieser Idee folgt, könnte der Präambel-Text wie folgt lauten:
Präambel
Beide Seiten sehen in der KI-Technik der Chatbots eine Universaltechnik, die geeignet ist, alle Arbeitsbereiche zu durchdringen. Sie stimmen in der Auffassung überein, diese Technik nur zur Unterstützung der von Menschen geleisteten Arbeit einzusetzen
und nicht deren Arbeit zu ersetzen.
Anbetracht der noch hohen Entwicklungsgeschwindigkeit der Technik verständigen sich beide Seiten auf eine Experimentierphase, um die sinnvollen Chancen der Technik zu erkennen, sie auszunutzen und deren Risiken und Gefahren zu minimieren.
Unternehmen und Betriebsrat verständigen sich daher auf einen Erfahrungsaustausch während der Experimentierphase und nehmen nach deren Ablauf eine gemeinsame Bewertung vor, die auch der Festlegung des weiteren Verfahrens dient.
Eine Präambel regelt zwar nichts, aber sie drückt den gemeinsamen spirit aus, dem sich beide Seiten verpflichtet fühlen.
Gestaltung der Experimentierphase
Für einen Einstieg in die Technik bieten sich einem Unternehmen zwei unterschiedliche Vorgehensweisen an:
- Software as a Service(SaaS): Man entscheidet sich zum Beispiel für Microsoft Copilot. Es ist ein nach best practices des Herstellers vorbereitetes Softwarepaket, das einen Chatbot beinhaltet. Unter anderem aus Angst vor der Unberechenbarkeit der aktuellen US-amerikanischen Politik wird auch die Installation in einer auf Rechnern im EU-Raum installierten Cloud angeboten.
- Eigene Entwicklung: Man entscheidet sich für eines der inzwischen zahlreichen von den BigTech-Firmen unabhängiges Softwarepaket, das - wenn man will - sogar on premises, also im Rechenzentrum oder in einer private cloud des Unternehmens installiert werden kann. Letzters verspricht uneingeschränkte eigene „Lufthoheit“ über die Technik.
Die vom Unternehmen gewählte Strategie sollte dem Betriebsrat ausführlich erläutert werden, mit dem Ziel, eine gemeinsame Aufmerksamkeit für die durch das politische Umfeld verursachten Risiken zu entwickeln. ImText der Betriebsvereinbarung könnte diesem Anliegen wie folgt Rechnung getragen werden:
Architektur des Systems
Hier ist zu beschreiben, in welcher Form die Technik installiert wird, z.B. Microsoft Copilot oder ein anders Software-as-a-Service-Angebot. Die technischen und/oder organisatorischen Bemühungen, wie dabei das europäische Datenschutzrecht eingehalten wird, sollten ebenfalls beschrieben werden.
Wenn eine Lösung mit unternehmensspezifischem Chatbot gewählt wurde, sollte die ausgewählte Software benannt werden. Wenn das System mit unternehmensspezifischen Daten ergänzt wurde, geht dem vermutlich eine strategische Entscheidung des Unternehmens voraus, bei der auch festgelegt wurde, welche Unternehmensteile betroffen sind, z.B. Marketing, Vertrieb oder ein logistischer Bereich. Auch diese sollten benannt werden.
Arbeitsweise
Man kann natürlich die Beschäftigten des ganzen Unternehmens mit den Tools vor sich hin probeln lassen. Sinnvoller als alles auf einmal einzuführen ist allerdings ein schrittweises Vorgehen, beginnend mit einem Pilotbereich. Die Erfahrungen aus diesem Bereich können dann weiteren Schritten der Einführung zugute kommen.
Stufenweise Einführung
Das Unternehmen verfolgt (innerhalb seiner KI-Strategie) das Ziel, Chatbots als allgemeines Arbeitswerkzeug zur Verfügung zu stellen.
Zum Start wird ein Pilotbereich ausgewählt, für den nach Auffassung beider Seiten günstige Voraussetzungen für eine sinnvolle Integration eines Chatbots in die Tagesarbeit bestehen. Dabei wird wie folgt vorgegangen:
- Der IT-Bereich des Unternehmens bildet eine Task Force von Experten, die sich befähigen, die Einsatzmöglichkeiten der Technik den unterschiedlichen Geschäftsbereichen verständlich und inspirierend zu erläutern.
- Die IT-Task Force und Vertreter des für den ersten Polotversuch ausgewählten Bereichs veranstalten ein Brainstorming, in dem die Erwartungen an den Nutzen des Chatbot-Einsatzes gemeinsam erörtert werden. Beide Seiten bemühen sich dabei um eine offene Atmosphäre, die technische Schwierigkeiten und Kosten zunächst nicht als Ausschlussfaktoren begreift. Die bisherige Erfahrung hat schließlich gezeigt, wie schnell sich sowohl Leistungsumfang als auch Kosten verändern.
- Teamauswahl: Mit Blick auf die späteren Benutzerinnen und Benutzer wird auf eine hohe Diversität des Teams geachtet. Neben technikbegeisterten Mitarbeitenden sollen auch Personen dem Team angehören, die der Technik eher skeptisch gegenüberstehen oder nur in gingem Maße technikaffin sind. Altersunterschiede sollten ebenfalls berücksichtigt sein.
- Aufgaben: Ausgehend von den Erwartungen aus dem Brainstorming werden mit Blick auf das ausgewählte Einsatzgebiet in einem gemeinsamen Lernprozess vom Team Fragen und Aufgabenstellungen formuliert, für die der Chatbot-Einsatz eine sinnvolle Arbeitsunterstützung verspricht. Man kann dabei durch Ausprobieren feststellen, wie man Fragen stellen muss, um sinnvollere Antworten zu erhalten (sog. Prompting). Ebenfalls lässt sich herausfinden, wo die Verlässlichkeit der Antworten aufhört und das System anfängt, zu halluzinieren.
- Die Beispielsammlung wird (mit Unterstützung der IT) online realisiert. Sie soll geeignet sein, in späteren Projektphasen auch anderen Beschäftigten als Trainingsmaterial zur Verfügung zu stehen.
- Eine Frist für das Projekt (Vorschlag maximal drei Monate) und ein Termin für die Ergebnisspräsentation werden zu Beginn des Projekts festgelegt.
Das Team erhält keine weiteren Vorgaben und organisiert seine Form der Zusammenarbeit selbst. Die Fristsetzung für die Ergebnispräsentation bereits zu Beginn der Arbeit ist wichtig, ebenso eine geeignete Form der Ergebnis-Präsentation für die Betriebsöffentlichkeit.
Wichtig ist der Grundsatz Lernen im Team. Konzepte erarbeiten und Erfahrungsaustausch sollten bevorzugt in Präsenz-Meetings erfolgen. Wenn dabei hybride Arbeitsformen (Mischung präsent-remote) gewählt werden, ist darauf zu achten, dass dafür geeignete Technik zur Verfügung steht.
Die Betriebsöffentlichkeit soll mitbekommen, dass die KI-Technik eine wichtige Rolle für die Arbeitsgestaltung der Zukunft spielt - deshalb die Verpflichtung des Teams zu einer Ergebnispräsentation.
Das Top-Management sollte deutlich zu erkennen geben, Wert darauf zu legen, dass der Umgang mit den Tools zur allgemein erworbenen Fähigkeit der Beschäftigten wird.
Eine Beispielsammlung für Chat-Anwendungen
Die Beispiele sind mit einem roten  Dreieck versehen. Durch Klick auf ein solches Dreieck können Sie den Text aufklappen. Das Dreieck ändert dann seine Form (
Dreieck versehen. Durch Klick auf ein solches Dreieck können Sie den Text aufklappen. Das Dreieck ändert dann seine Form ( ). Wenn Sie jetzt darauf klicken, werden die Texte wieder zugeklappt.
). Wenn Sie jetzt darauf klicken, werden die Texte wieder zugeklappt.
 |
Wer war der erste Präsident des Bundesarbeitsgerichts? Welcher Partei gehörte er an.- Von wann bis wann ging seine Präsidentschaft. Bitte kurze Antworten. |
| |
Bild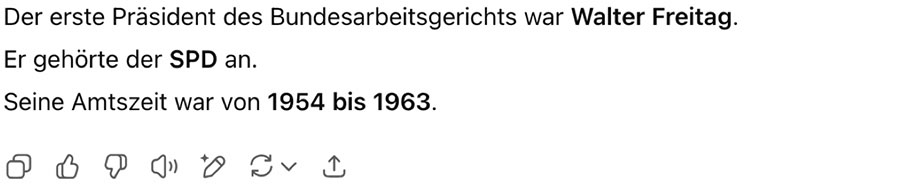
|
 |
Kannst Du mir helfen, eine Mail an einen Geschäftspartner zu schreiben? |
| |
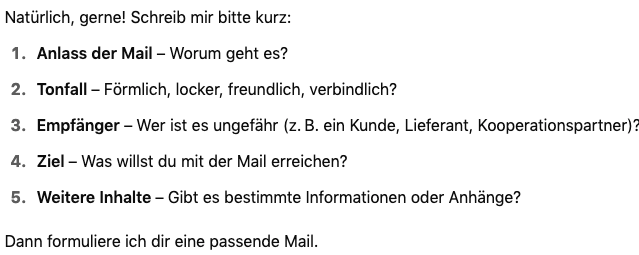
|
 |
Ich möchte einen Kickoff-Vortrag über das Change Management halten. Mach mir einen Vorschlag für die Strukturierung des Vortrags. ........
Schreib mir das bitte etwas kürzer. |
| |
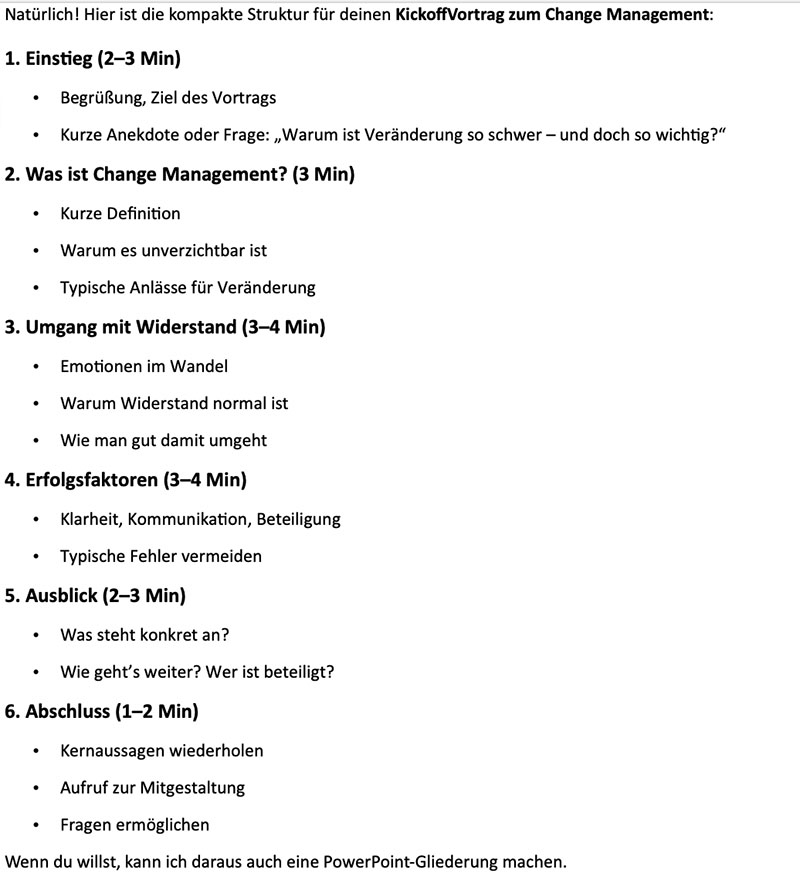
|
 |
Stimmt es, dass der Schriftsteller Charles Dickens sich seinen Lebensunterhalt damit verdienen musste, seine Romane als Fortsetzungen in Tageszeitungen zu schreiben? |
| |
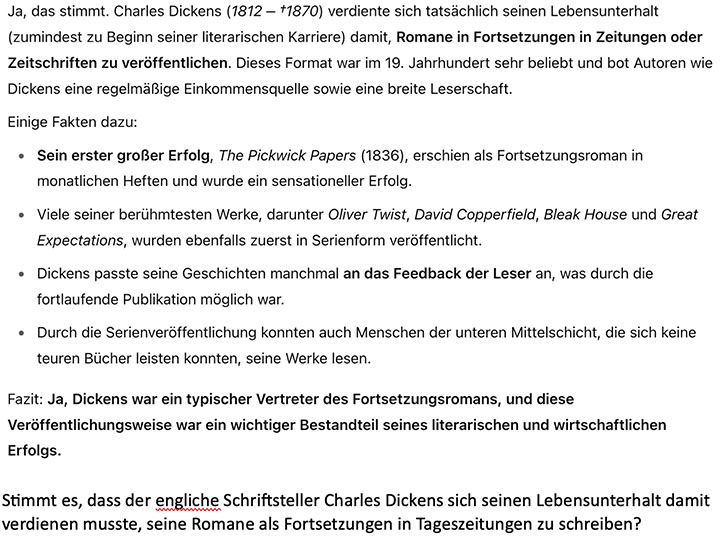
|
Die Beispiele sind sicher nicht die besten. Aber man sieht, dass sie bei vielen Aufgaben hilfreich sein können. Sie sind aber auch eine überzeugende Bestätigung des Sprichworts
„wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück“.
oder besser gesagt „garbage in - garbage out“. Kein Chatbot kann erkennen, ob jemand ihm hochintelligente oder ziemlich dumme Fragen stellt. Er antwortet immer nur nach bester Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeiten liefert ihm seine gigantische Datenmasse, mit der er trainiert wurde. Deren Spanne umfasst ebenfalls die komplette Spannbreite von hochintelligent bis ziemlich dumm. (mehr über die Qualität der Trainingsdaten).
Datenschutz
Welche Lernform auch immer gewählt wird, sie sollte auch Verhaltensweisen zum Datenschutz zum Thema machen. Dies betrifft nicht nur die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern berührt auch die Interssen des Unternehmens, vor allem wenn es sich um einen US-amerikanischer Provider handelt.
Unklar bleibt dabei (Stand Sommer 2025), ob der Provider Daten von Eingaben der Benutzer zu Trainingszwecken seiner eigenen Systeme benutzt. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit, dass Informationen über Interna des Unternehmens bei anderen Benutzern außerhalb des Unternehmens erscheinen können. Die einzige verlässliche Abhilfe besteht im Abschluss eines Zero-Data-Retention-Vertrags mit dem Provider - oder die Installation eines Chatbots in eigener Regie, im Rechenzentrum des Unternehmens oder seiner Private Cloud. Inzischen gibt es zahlreicher werdende Angebote gür solche Lösungen (siehe Eigene Chatbots bauen).
Evaluation
Es gibt viele Möglichkeiten, wie der Betriebsrat das Projekt begleiten kann: Entsendung eines oder mehrerer Vertreter in der Projektgruppe oder regelmäßige Besprechungs- bzw. Beratungstermine.
Die erste Variante bietet sich an, wenn eine Kollegin oder ein Kollege des Betriebsrats in einem der betroffenenen Bereiche des Pilotprojekts arbeitet, hat aber den Nachteil, sich dauerhaft um den gebotenen kritischen Abstand bemühen zu müssen.
Ergebnis der Evaluation kann sein, das gesamte Vorhaben
- durch weitere Pilotprojekte fortzusetzen,
- verständliche Leitlinien für den Umgang mit der Technik zu formulieren und
- Unterstützung für die Qualifizierung der Beschäftigten zu organisieren.
Wie dies im einzelnen geschieht, sollte in einem auf Dauer gestellten Prozess zwischen den Betriebsparteien ausgehandelt werden. Der Betriebsrat sollte sich stets bewusst sein, dass ihm in dieser Angelegenheit ein Initiativrecht zusteht.
Begleitende Rahmenbedingungen
Es versteht sich von selbst, dass die KI-Technik nicht zur Überwachung der Beschäftigten eingesetzt wird und dass die Chancen für das Erlernen einer sinnvollen Nutzung allen Beschäftigten zusteht, deren Arbeit durch Computereinsatz geprägt ist.
In vielen Betrieben gibt es Rahmenbetriebsvereinbarungen, entweder für den IT-Einsatz allgemein oder sogar speziell für KI-Systeme, in denen solche Grundsätze sowie die Beteiligung des Betriebsrats bereits vereinbart sind.
In solchen Regelungen sind in der Regel kritische oder gefährliche Anwendungen ausgeschlossen (siehe IT-Rahmenbetriebsvereinbarung).
Fazit
Die KI-Tools sind noch zu neu, um auf allgemein anerkannte Standards ihrer Regelung zurückgreifen zu können. Deshalb gilt es, aus Erfahrung zu lernen, und Wege zu finden, wie aus dem praktisch erlebten Umgang mit der Technik weitere Initiativen aufgebaut werden können.
Bekanntlich ist nichts so erfolgreich wie Erfolg. Also kommt es darauf an, die Erfolge auch spürbar werden zu lassen, vor allem die positive Erfahrung, wie die Chatbot-Technik die Arbeit besser, leichter und freudiger macht. Es gilt, ein Gespür dafür zu entwickeln, wo die Chancen liegen und wo der Einsatz nichts bringt.
Gemeinsame Aufgabe des Managements und des Betriebsrats ist es, die Rahmenbedingungen für die positiven Nutzungschancen zu schaffen.



