Planen, Sammeln und Ausprobieren
Es hat dann doch noch ein gutes Jahr gedauert, bis die neue Firma gegründet wurde.
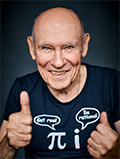 Die PAISY-Show hatte sich schnell rundgesprochen, fand das Wohlgefallen der zuständigen Gewerkschaft, der IG Metall, und bescherte mir mit deren Unterstützung eine Menge Kundschaft, Landesbezirk Baden Württemberg, genauer Schwäbische Alb.
Die PAISY-Show hatte sich schnell rundgesprochen, fand das Wohlgefallen der zuständigen Gewerkschaft, der IG Metall, und bescherte mir mit deren Unterstützung eine Menge Kundschaft, Landesbezirk Baden Württemberg, genauer Schwäbische Alb.
Es ging hauptsächlich um in der Produktion eingesetzte Systeme, Betriebsdatenverarbeitung halt, Planzeiten für einzelne Arbeitsgänge, oft als Vorgabezeiten missverstanden, Rückmeldungen der wirklich verbrauchten Daten und alles personenbzogen natürlich. Kontrolle pur, und das auch noch, ohne dass man das merkt, so die Befürchtungen. Damals schon erkennbar: Alles an Daten einzusammeln, was sich nicht wehrt, völlig egal, ob man es braucht oder nicht - aber noch weit weg vom Big Data-Geschäft heutiger Tage.
Kampf um Mitbestimmung
Erschwerend kam noch der damals verbreitete deutlich patriarchalische Führungsstil hinzu. Die Arbeitgeber verstanden die Welt nicht mehr. Betriebsräte mischten sich ein in Dinge, die sie doch gar nichts angehen, so eine verbreitete Auffassung. Und damit war auch die erste Abwehrlinie klar: Bestreitung der Mitbestimmung.
Schützenhilfe war die schlampige Formulierung im Betriebsverfassungsgesetz. Im § 87 heißt es unter anderem, dass der Betriebsrat mitzubestimmen hat bei der
Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen.
Das Wort bestimmt war der Ankerpunkt des Streits. Gängige Argumentation: Klar, objektiv können wir euch überwachen, aber wir wollen das ja gar nicht. Und deshalb ist die Technik auch nicht zur Überwachung bestimmt. Und - nochmal deshalb - habt ihr, Betriebsräte auch nichts mitzubestimmen.
Lösungsversuche
Mein Job war dann, die Protagonisten solcher Entschuldigungen beim Wort zu nehmen, nach dem Motto, wenn ihr schon niemanden überwachen wollt, dann sorgen wir dafür, dass dies techisch auch gar nicht möglich ist. Das war relativ einfach:
- Erster Schritt herausfinden, was sind die Ziele, z.B. Planung der Produktion, Steuerung des wirklichen Produktionsablaufs, Intervention bei Störungen usw.
- Zweiter Schritt: herausfinden, wie sich die Ziele ohne Überwachung der betroffenen Menschen erreichen lassen.
Oft genügte schon der Verzicht auf den Personenbezug der Daten. Wo das nicht möglich war, z.B. bei Akkordarbeit, eine Zweckbindung durch Regelung der Verarbeitung hinzubekommen, die auch nichts anderes zuließ. Die ersten Betriebsvereinbarungen aus dieser Zeit zeigen viele Varianten dieses Vorgehens.
Unterhaltungswert
Es gab auch reichlich Kurioses. Die Auseinandersetzung fiel in eine Zeit, in der die IG Metall die Erkämpfung der 35-Stunden-Woche auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Man ließ sich viel einfallen, z.B. Luftballons mit der 35-Stunden-Aufschrift während der Betriebsversammlung steigen zu lassen. Das fand in einem mittelständischen Betrieb überhaupt kein Verständnis in der Chefetage, und der Unternehmer höchstpersönlich erschien in der Versammlung, bewaffnet mit einer Schrotflinte, und schoss die Luftballons ab. Da war natürlich Stimmung in der Bude. Aber man nahm das eher sportlich, keine Polizei, war halt nur ein Versuch.
EMIL ohne Detektive
 Der in meiner Zählung zehnte Betrieb hatte es in sich. Es handelte sich um die HHLA, die Hamburger Hafen und Lagerhaus Aktiengesellschaft, wie sie damals hieß; heute hat man das Lagerhaus durch Logistik ersetzt. Der Aufreger war ein Softwaresystem namens EMIL, im Wortlaut: Einteilung mit integrierter Lohnerkennung.
Der in meiner Zählung zehnte Betrieb hatte es in sich. Es handelte sich um die HHLA, die Hamburger Hafen und Lagerhaus Aktiengesellschaft, wie sie damals hieß; heute hat man das Lagerhaus durch Logistik ersetzt. Der Aufreger war ein Softwaresystem namens EMIL, im Wortlaut: Einteilung mit integrierter Lohnerkennung.
Es war eine Zeit, in der die Containerisierung die Arbeitsplätze noch nicht weggefegt hatte. Es gab sogar einen Betrieb, der sorgte für die Vermittlung von Hafenarbeiter, um die Personalbedarfslücken der damals noch rund 40 Hafeneinzelbetriebe wegen der starken Umsatzschwankungen zu schließen. Der Betriebsratsvorsitzende schleppte mich mit in eine Betriebsversammlung, mit den Begrüßungsworten: Was du hier siehst, sind mindestens 500 Jahre Knast. Alles klar.
Zurück zur HHLA. Es ging, wie in vielen Hafenbetrieben, um die Einteilung der Hafenarbeiter in sogenannte Gänge, zum Laden oder Löschen der Schiffe. So ein Gang war eine Gruppe von acht bis 12 Arbeitern, die unterschiedliche Skills haben mussten, z.B. Führerscheine für die vielen exotischen Geräte wie Van-Carrier, wo man in drei bis vier Meter Höhe in einem Glaskasten saß und in oft abenteuerlichem Tempo das schwere Gefährt durch den Hafen steuerte. Damals gab es auch noch Berufe wie Tallymann, zuständig für die Vermessung der Ware beim Einlagern in das Schiff, bevor spezielle Computerprogramme den Job übernahmen. Ein paar Hundert dieser Skills gab es. Die Besetzung der Gänge sollte EMIL übernehmen, darüber hinaus aber auch die exakte Berechnung und Zuteilung der vielen tariflichen Zuschläge für besondere Einsatzbedingungen, beispielsweise die Höhenzulage für die Van-Carrier-Fahrer. Das war reichlich kompliziert, weil es auch noch auf die Länge der Zeit ankam.
Ich konnte es nie überprüfen, erzählt wurde, dass auch Lohn für nicht vorhandene Gangmitglieder gezahlt und unter den Mitgliedern der Gruppe verteilt wurde. Man muss sich das so vorstellen, dass es für jeden Beschäftigten eine Art Postfach gab, in der jeder in einer Papiertüte seinen wöchentlichen Lohn erhielt.
Es war ein kompliziertes Unterfangen, alles richtig zu berechnen, mit vielen Streitereien und wohl auch Mauscheleien. Dem sollte EMIL ein Ende setzen. Der Betriebsrat war tief gespalten, eine Gruppe, die das System um jeden Preis verhindern wollte, die Mehrheit mit realistischem Blick, dass dieses Ziel nicht erreichbar war, aber mit großer Sehnsucht, wie kommen wir da mit Anstand raus. Mein Job. Tagelang habe ich mir alles angesehen, mit vielen Menschen gesprochen, Diskussionen bis tief in die Nacht. Ellenlange Verhandlungen. Am Schluss aber eine brauchbare Vereinbarung: EMIL ohne Detektive, fand auch Hamburgs damaliger Erster Bürgermeister Klaus von Dohnanyi cool, auf einer Betriebsversammlung im Hamburger Congress Center vor rund 3000 Anwesenden.
Die EMIL-Auseinandersetzung bedeutete für mich intensiven Kontakt mit der EDV-Abteilung, so hieß das damals. IT und Informationstechnik waren noch nicht die Vokabeln. Mit dem Chef der Abteilung und seinen engsten Mitarbeitern habe ich viele Stunden zusammengesessen; es ging um das Ausbaldowern oft sehr detaillierter Entscheidungen, die auch für die Arbeitgeberseite zumutbar waren.
Erfahrungen
Für mich war wichtig, zu sehen, worum es in den Betrieben ging. Ich konnte die gängigen Softwaresysteme kennen und den Respekt vor ihnen verlieren lernen, schnell sehen, wie man die beabsichtigten Ziele eleganter, schonender und viel einfacher erreichen konnte, durch ein paar Eingriffe in die Programme. Ich sah das hohe Interesse an der Auseinandersetzung mit der Technik, und es gab reichlich Nachfrage nach Unterstützung, die ich anbieten konnte. Das Argument „geht nicht“ zog nicht. Den Betriebsräten gefiel der große Respekt, den mir die leitenden Manager entgegenbrachten. Die Auseinandersetzungen waren immer Chefsache.
Nun stand fest: Das Wagnis einer Firmengründung war keine Traumtänzerei. Die Kehrseite: Es war eine Zeit ohne Acht-Stunden-Tage, auch keine Fünf-Tage-Woche, ganz das Gegenteil, wofür die IG Metall damals stritt.
 Mit Blick auf 40 Jahre später fällt auf, dass damals das Computergeschehen vor Ort stattfand, Software war auf den Rechnern der Unternehmen installiert, ferne Clouds mit kaum veränderbaren Standards gab es noch nicht. Vieles war selbst entwickelt, die Anwendungsentwicklung der Firmen hatte reichlich Arbeit, und es war Gang und Gäbe, dass an der eingekauften Software herumgebastelt wurde.
Mit Blick auf 40 Jahre später fällt auf, dass damals das Computergeschehen vor Ort stattfand, Software war auf den Rechnern der Unternehmen installiert, ferne Clouds mit kaum veränderbaren Standards gab es noch nicht. Vieles war selbst entwickelt, die Anwendungsentwicklung der Firmen hatte reichlich Arbeit, und es war Gang und Gäbe, dass an der eingekauften Software herumgebastelt wurde.

